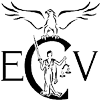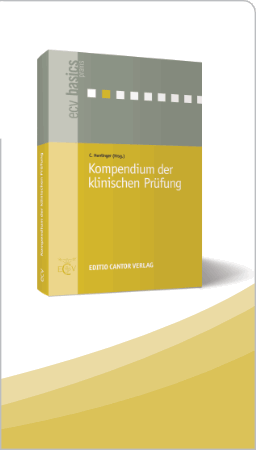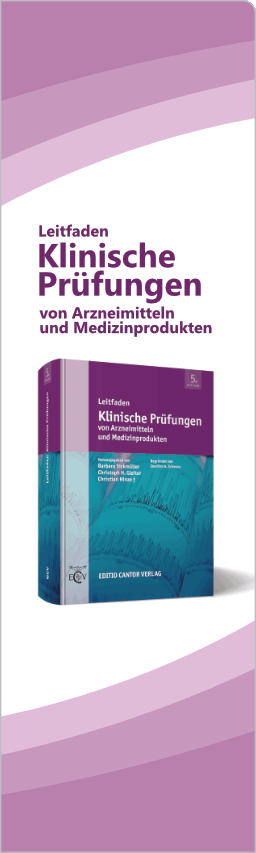Ihr Suchergebnis
Sie recherchieren derzeit unangemeldet.Melden Sie sich an (Login) um den vollen Funktionsumfang der Datenbank nutzen zu können.
In der Rubrik Zeitschriften haben wir 11884 Beiträge für Sie gefunden
-
Bericht aus Großbritannien 03/2007
Rubrik: Ausland
(Treffer aus pharmind, Nr. 03, Seite 334 (2007))
Bericht aus Großbritannien 03/2007 / Woodhouse R
-
Patentspiegel 03/2007
Rubrik: Patentspiegel
(Treffer aus pharmind, Nr. 03, Seite 339 (2007))
Patentspiegel 03/2007 / Cremer K
-
European Qualified Person Association - eine neue Mitgliederorganisation in Europa
Rubrik: GMP-Expertenforum
(Treffer aus pharmind, Nr. 03, Seite 345 (2007))
European Qualified Person Association - eine neue Mitgliederorganisation in Europa / Renger B
-
NIR-Technologie - ein neuer Ansatz für thermische Prozesse bei der Verpackung von Pharmaprodukten / Teil 2
Rubrik: Originale
(Treffer aus pharmind, Nr. 03, Seite 348 (2007))
NIR-Technologie - ein neuer Ansatz für thermische Prozesse bei der Verpackung von Pharmaprodukten / Teil 2 / Dienz M
-
Produktinformationen 03/2007
Rubrik: Produktinformationen
(Treffer aus pharmind, Nr. 03, Seite 352 (2007))
Produktinformationen 03/2007 /
-
Buchbesprechungen 03/2007
Rubrik: Buchbesprechungen
(Treffer aus pharmind, Nr. 03, Seite 356 (2007))
Buchbesprechungen 03/2007 /
-
Risikomanagement bezüglich der Ausgangsstoffe
Rubrik: Sonderthema
(Treffer aus pharmind, Nr. 03, Seite 359 (2007))
Risikomanagement bezüglich der Ausgangsstoffe / Metzger K
Risikomanagement bezüglich der Ausgangsstoffe Karl Metzger Welding GmbH & Co. KG, Hamburg Korrespondenz: Karl Metzger, Welding GmbH & Co. KG, Esplanade 39, 20354 Hamburg (Germany), e-mail: karl.metzger@web.de Das Thema Ausgangsstoffe sollte integraler Bestandteil des Risikomanagements sein. Im Dokument ICH Q9 finden sich diesbezüglich vor allem im Annex 2 Anregungen zur Betrachtung des Materialmanagements. Zur Risikoidentifizierung bezüglich der Ausgangsstoffe sind vor allem die Herstellungsprozesse, die Supply Chain und der innerbetriebliche Umgang mit Ausgangsstoffen zu betrachten. Risikomanagement als Teil des Materialmanagements sollte nach ICH Q9 folgende Punkte berücksichtigen: Bewertung und Evaluierung von Lieferanten und Lohnherstellern Ausgangsmaterial Verwendung des Materials Lagerungs- und Transportbedingungen Key words Ausgangsstoff • HACCP • Lieferantenqualifizierung • Risikomanagement • Transport © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2007
-
Solupharm GmbH
Rubrik: Unternehmensprofile
(Treffer aus pharmind, Nr. 03, Seite 324 (2007))
Solupharm GmbH /
-
Bericht von der Börse 03/2007
Rubrik: Wirtschaft
(Treffer aus pharmind, Nr. 03, Seite 327 (2007))
Bericht von der Börse 03/2007 / Batschari A
-
Essentials aus dem Pharma- und Sozialrecht 03/2007
Rubrik: Gesetz und Recht
(Treffer aus pharmind, Nr. 03, Seite 322 (2007))
Essentials aus dem Pharma- und Sozialrecht 03/2007 /
Sie sehen Artikel 10471 bis 10480 von insgesamt 11884
- Erste Seite
- 1046
- 1047
- 1048
- 1049
- 1050
- Letzte Seite