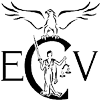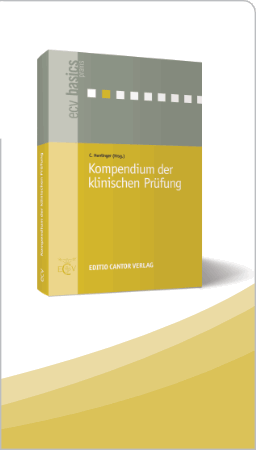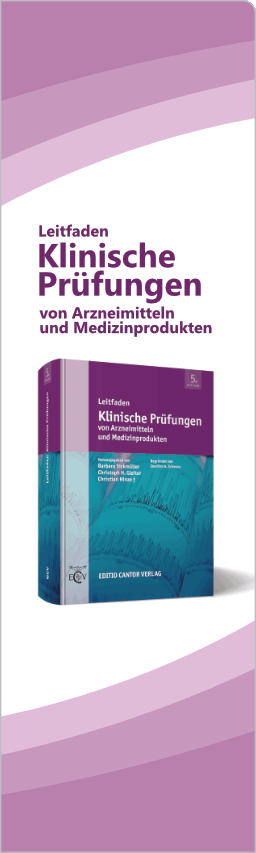Ihr Suchergebnis
Sie recherchieren derzeit unangemeldet.Melden Sie sich an (Login) um den vollen Funktionsumfang der Datenbank nutzen zu können.
In der Rubrik Zeitschriften haben wir 11911 Beiträge für Sie gefunden
-
Aktuelles 12/2000
Rubrik: Aktuelles
(Treffer aus pharmind, Nr. 12, Seite XII/250 (2000))
Aktuelles 12/2000 /
-
Info-Börse 12/2000
Rubrik: Info-Börse
(Treffer aus pharmind, Nr. 12, Seite XII/257 (2000))
Info-Börse 12/2000 /
-
In Wort und Bild 12/2000
Rubrik: In Wort und Bild
(Treffer aus pharmind, Nr. 12, Seite XII/261 (2000))
In Wort und Bild 12/2000 /
-
Rechtsprechung- Zulassungswiderruf durch EU-Kommission / vorläufiger Rechtsschutz
Rubrik: Gesetz und Recht
(Treffer aus pharmind, Nr. 09, Seite 669 (2000))
Rechtsprechung- Zulassungswiderruf durch EU-Kommission / vorläufiger Rechtsschutz /
Zulassungswiderruf durch EU-Kommission / vorläufiger Rechtsschutz (Europäisches Gericht Erster Instanz, Beschluß des Präsidenten vom 28. 7. 2000 -AZ: T-74/00R) Das Europäische Gericht Erster Instanz (EuG) hat durch Beschluß des Präsidenten des Gerichts vom 28. 7. 2000 den Vollzug einer Entscheidung der EU-Kommission zum europäischen Arzneimittelrecht ausgesetzt. Die EU-Kommission hatte den Mitgliedstaaten durch Entscheidung vom 9. 3. 2000 (AZ: K [2000] 453) aufgegeben, die nationalen Zulassungen für - u. a. - Amfepramon- haltige Arzneimittel zu widerrufen. Gemäß der Richtlinie 75/319 vom 20. 5. 1975 war den Mitgliedstaaten eine Frist von 30 Tagen gesetzt worden, der Entscheidung nachzukommen. Das gegen die Kommissionsentscheidung am 30. 3. 2000 angerufene EuG hatte bereits am 11. 4. 2000 durch seinen Präsidenten eine Zwischenentscheidung getroffen, damit keine sofort vollziebaren Widerrufsentscheidungen der nationalen Behörden vor einer Entscheidung des EuG im einstweiligen Rechtsschutz ergehen. In dem Beschluß vom 28. 6. 2000 hat der Präsident des Gerichts in bezug auf die Antragstellerin den Vollzug der Kommissionsentscheidung vom 9. 3. 2000 bis zu einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren vorläufig ausgesetzt. Das EuG sah ausreichende Anhaltspunkte für eine Rechtswidrigkeit der Kommissionsentscheidung. Zum einen hielt das Gericht für zweifelhaft, ob die Kommission ihre Entscheidung auf Art. 15a der Richtlinie 75/319/EWG stützen durfte. Zudem konnte sich das Gericht nicht von der Verhältnismäßigkeit des den Mitgliedstaaten aufgegebenen Widerrufs überzeugen, da die Kommission noch Ende 1996 in Kenntnis der Sachlage von einem Widerruf abgesehen hatte. Von besonderer Bedeutung sind die Ausführungen des Gerichts zum Maßstab der Dringlichkeit, an dem Aussetzungsanträge in der Luxemburger Praxis vielfach scheitern. Das Gericht bestätigt den Vortrag der Antragstellerin, daß durch den sofortigen Vollzug der Kommissionsentscheidung - und damit sofort vollziehbaren Widerrufsentscheidungen auf nationaler Ebene - dem betroffenen Unternehmen ein schwerer und nicht wiedergutzumachender Schaden entstehen würde. Der sofortige Vollzug bedeutet nach der Einschätzung des Gerichts, daß die betroffenen Arzneimittel im Pharmahandel ausgelistet und in der Verschreibungspraxis der Ärzte durch andere Präparate substituiert würden. Der Beschluß hat folgenden Wortlaut (Auszug): © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2000 -
Bericht aus Großbritannien 02/2000
Rubrik: Ausland
(Treffer aus pharmind, Nr. 02, Seite 127 (2000))
Bericht aus Großbritannien 02/2000 / Woodhouse R
-
Bericht aus Großbritannien 04/2000
Rubrik: Ausland
(Treffer aus pharmind, Nr. 04, Seite 286 (2000))
Bericht aus Großbritannien 04/2000 / Woodhouse R
-
Bericht aus Großbritannien 05/2000
Rubrik: Ausland
(Treffer aus pharmind, Nr. 05, Seite 358 (2000))
Bericht aus Großbritannien 05/2000 / Woodhouse R
-
Bericht aus Großbritannien 06/2000
Rubrik: Ausland
(Treffer aus pharmind, Nr. 06, Seite 433 (2000))
Bericht aus Großbritannien 06/2000 / Woodhouse R
-
Bericht aus Großbritannien 03/2000
Rubrik: Ausland
(Treffer aus pharmind, Nr. 03, Seite 202 (2000))
Bericht aus Großbritannien 03/2000 / Woodhouse R
-
Rechtsprechung- Gericht stoppt Neufassung der Arzneimittel-Richtlinien
Rubrik: Gesetz und Recht
(Treffer aus pharmind, Nr. 12, Seite 948 (2000))
Rechtsprechung- Gericht stoppt Neufassung der Arzneimittel-Richtlinien /
Gericht stoppt Neufassung der Arzneimittel-Richtlinien (LG Hamburg, Urteil vom 31. März 1999, Az.: 315 O 129/99) Das Landgericht untersagt dem Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, die Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung in der am 8. Januar 1999 beschlossenen Neufassung, deren Inkrafttreten zum 1. April 1999 beabsichtigt war, bekanntzumachen oder bekanntmachen zu lassen, soweit darin bestimmte Arzneimittelgruppen von der Verordnungsfähigkeit zu Lasten der GKV ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung bejaht das Gericht ausdrücklich, daß der Zivilrechtsweg gem. den §§ 13 GVG und 87 GWB alte Fassung eröffnet ist. Die Partei- und Prozeßfähigkeit des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen wird bestätigt. Die Begründetheit des Antrages stützt das Landgericht auf die §§ 823 Abs. 2, 1004 BGB i. V. m. Art. 85 (jetzt 81) EG-Vertrag. Es bejaht die Unternehmenseigenschaft des Bundesausschusses und qualifiziert die vorliegenden Richtlinien als einen Beschluß von Unternehmensvereinigungen bzw. eine Vereinbarung von Unternehmen. Das Landgericht setzt sich dabei auch mit der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH auseinander. Es führt weiter aus, daß der Bundesausschuß jedenfalls deshalb als unternehmerisch handelnde Einheit anzusehen sei, weil die Arzneimittel-Richtlinien in der Neufassung nicht durch § 92 SGB V gedeckt seien. Das Gericht läßt es dahinstehen, ob der Unterlassungsanspruch auch auf § 1 UWG gestützt werden kann. Dieses war vom OLG München in einem Urteil vom 20. Januar 2000 (Az.: U (K) 4428/99) bejaht worden, während es die EG-kartellrechtlichen Unterlassungsansprüche dahinstehen ließ. Die schriftliche Ausfertigung dieses am 31. März 1999 verkündeten Urteils wurde den Parteien im Juli 2000 zugestellt; es hat folgenden Wortlaut (Auszug): © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2000
Sie sehen Artikel 11191 bis 11200 von insgesamt 11911
- Erste Seite
- 1118
- 1119
- 1120
- 1121
- 1122
- Letzte Seite