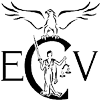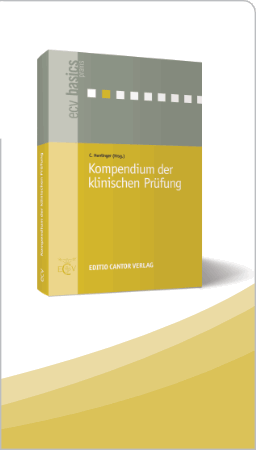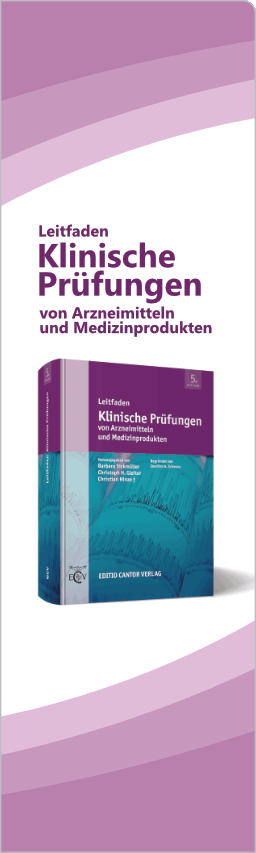Ihr Suchergebnis
Sie recherchieren derzeit unangemeldet.Melden Sie sich an (Login) um den vollen Funktionsumfang der Datenbank nutzen zu können.
In der Rubrik Zeitschriften haben wir 11727 Beiträge für Sie gefunden
-
Selbstinspektion - Auditierung - Audit-Tourismus / Ein Diskussionsbeitrag zur Bewertung von Ziel, Zweck und Wirtschaftlichkeit von Inspektionen und Inspektionsgemeinschaften
Rubrik: GMP / GLP / GCP
(Treffer aus pharmind, Nr. 07, Seite 598 (1999))
Selbstinspektion - Auditierung - Audit-Tourismus / Ein Diskussionsbeitrag zur Bewertung von Ziel, Zweck und Wirtschaftlichkeit von Inspektionen und Inspektionsgemeinschaften / Prinz H
Selbstinspektion - Auditierung - Audit-Tourismus Ein Diskussionsbeitrag zur Bewertung von Ziel, Zweck und Wirtschaftlichkeit von Inspektionen und Inspektionsgemeinschaften Dr. Heinrich Prinz, Leiter Zentrale Qualitätssicherung der Biotest AG, Dreieich Selbstinspektionen sind im pharmazeutischen Unternehmen eine gesetzliche Verpflichtung. Dies bedeutet, daß laufend interne Abläufe in Abteilungen oder Bereichen auf Konformität mit den gesetzlichen Vorgaben durch kompetentes, firmeneigenes Personal oder durch eine unabhängige Person überprüft werden müssen. Hierbei wird zum einen auf die ausreichende Umsetzung der notwendigen Regelungen interner als auch externer Art geachtet, zum anderen auf die Beachtung und strikte Umsetzung der Vorgabedokumente (SOPs) auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Eindeutigkeit und Wirksamkeit der festgelegten Maßnahmen. Um die Qualität der von externen Lieferanten und Unterauftragnehmern erbrachten Leistungen und Lieferungen zu belegen, wird immer mehr gefordert, daß auch eine Auditierung dieser Unternehmen nach Vertragsabschluß regelmäßig durch den Auftraggeber durchgeführt werden soll. Grundsätzlich ist eine Überprüfung (Auditierung) der Lieferanten und Unterauftragnehmer zu begrüßen, wenn konkrete Anlässe es notwendig machen oder sie Zulieferer qualitätsrelevanter Produkte und Arbeiten sind. Mittlerweile hat aber das externe Auditing Züge angenommen, die sehr oft mehr hinderlich als hilfreich sind und weit über das angestrebte Ziel hinausschießen. Es soll diskutiert werden, inwieweit laufende Lieferanten-Audits nach Vertragsabschluß sowohl für den Auditierten als auch für den Auditor bzw. seinem Auftraggeber wirklichen Nutzen bringen. Es wird diskutiert, ob es angebracht ist und welchen Vorteil es bringt, Audits für verschiedene Unternehmen zusammenzufassen und durch einen Unternehmensmitarbeiter oder durch externe, unabhängige Stellen (Consultants) durchführen zu lassen. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-
Eine Systemsicht für unternehmerisches Handeln in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung / 1. Mitt
Rubrik: Fachthemen
(Treffer aus pharmind, Nr. 01, Seite 1 (1999))
Eine Systemsicht für unternehmerisches Handeln in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung / 1. Mitt / Steiner M
Eine Systemsicht für unternehmerisches Handeln in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung 1. Mitteilung Dr. Nikolas Vrettos und Dr. Michael Steiner, The Boston Consulting Group GmbH & Partner, Düsseldorf und München ,,Auf dem Gebiet der Forschung kann nur derjenige Chancen nutzen, der darauf auch vorbereitet ist (Louis Pasteur) Innovation wird häufig als Ergebnis von Intuition, Kreativität und glücklichem Zufall angesehen. Ein weit verbreitetes Rezept lautet deshalb: Man starte eine Vielzahl von Projekten, stelle entsprechende Personen dafür ab und schaffe ein Klima minimaler Kontrolle. Auch wenn ein Teil der Projekte fehlschlägt, wird es so genug Projekte geben, die als gute Forschung und Entwicklung bezeichnet werden können -Prinzip Hoffnung. Dieser Führungsstil war in den 50er und 60er Jahren durchaus erfolgreich, als die Möglichkeiten für Innovationen grenzenlos schienen, als neue Produkte problemlos entwickelt werden konnten und sich der Markterfolg verhältnismäßig leicht vorhersagen ließ. Jeder, der heute mit technologiebasierten Produkten zu tun hat, weiß jedoch, daß sich die Zeiten geändert haben und Veränderungen immer schneller eintreten. Angesichts rasanter technologischer Fortschritte scheint es, daß Intuition, Kreativität und Zufall für das Management jenseits der Kontrolle liegen. Dies ist jedoch keineswegs der Fall, wie die Beispiele einiger erfolgreicher Unternehmen zeigen. Aber was machen diese Unternehmen konkret anders? Vereinfacht könnte man sagen, sie haben sich und ihre Mitarbeiter auf alle Eventualitäten vorbereitet. Dabei steht es außer Frage, daß bei der Entwicklung innovativer Produkte auch ein gewisses Glück mit im Spiele ist, aber ein Unternehmen muß darauf vorbereitet sein, auf unerwartete Entwicklungen zu reagieren. Innovation kann nicht erzwungen werden, doch sie kann durch die entsprechenden organisatorischen Voraussetzungen und geschicktes Management begünstigt werden. Der vorliegende Artikel soll zeigen, wie ein Systemansatz helfen kann, sich auf mögliche Veränderungen vorzubereiten. Die meisten Elemente eines Systemansatzes sind für den Bereich Forschung und Entwicklung nicht neu, doch ihre konsequente Anwendung ist neu. Systemdenken ist eine Möglichkeit, eine Situation zu verstehen, nicht jedoch ein Problem zu lösen. Ein Systemansatz kann jedoch dabei helfen, ein Problem an der richtigen Stelle anzugehen, indem man es gleichzeitig auf drei Ebenen betrachtet: Ereignisse, Trends und Muster und Strukturen. Die Ereignisse sind sozusagen die Spitze des Eisbergs, Trends und Muster liegen noch oberhalb der Wasseroberfläche, aber die Strukturen sind die eigentliche treibende Kraft, die in der Tiefe verborgen ist. Die Strukturen zu verstehen ist das, worauf es ankommt. Viele Unternehmen nutzen Teile eines Systemansatzes, ohne daß es ihnen gelingt, davon deutlich zu profitieren, weil sie Zusammenhänge nicht erkennen und nicht dementsprechend handeln. Die Fachliteratur beschäftigt sich bisher nur mit Teilen eines solchen Ansatzes, ohne jedoch den Gesamtzusammenhang zu sehen. Ziel und Zweck des vorliegenden Artikels ist es, ein Rahmenwerk zu schaffen, das die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Implementierung eines Systemansatzes erhöht, und verschiedene Formen des Systemansatzes vorzustellen, die in der Forschung und Entwicklung relativ neu sind oder selten angewandt werden: Eine neue Struktur für die F&E-Organisation Ein eng gesteuertes technologiegetriebenes Forschungsprogramm, das Forschern erhebliche Freiräume gewährt Die Quantifizierung des Potentials einzelner Projekte sowie des gesamten F&E-Portfolios Ein synchronisierter Prozeß der Entscheidungsfindung und -umsetzung. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-
Aufbau, Implementierung und Ausbau eines Qualitätsmanagementsystems in einem pharmazeutischen Unternehmen / Zusammenführung der Qualitätsmanagementsysteme gemäß EG-GMP-Richtlinie, PharmBetrV und DIN EN ISO 9001/4 / Teil I: Benennung eines Qualitäts
Rubrik: GMP / GLP / GCP
(Treffer aus pharmind, Nr. 01, Seite 19 (1999))
Aufbau, Implementierung und Ausbau eines Qualitätsmanagementsystems in einem pharmazeutischen Unternehmen / Zusammenführung der Qualitätsmanagementsysteme gemäß EG-GMP-Richtlinie, PharmBetrV und DIN EN ISO 9001/4 / Teil I: Benennung eines Qualitäts / Prinz H
Aufbau, Implementierung und Ausbau eines Qualitätsmanagementsystems in einem pharmazeutischen Unternehmen Zusammenführung der Qualitätsmanagementsysteme gemäß EG-GMP-Richtlinie, PharmBetrV und DIN EN ISO 9001/4 Teil I: Benennung eines Qualitätssicherungsbeauftragten Dr. Heinrich Prinz, Leiter Zentrale Qualitätssicherung, Biotest AG, Dreieich Qualitätssicherungssysteme spielen in der pharmazeutischen Industrie eine immer wichtiger werdende Rolle. In den gesetzlichen oder darüber hinaus zu beachtenden Vorgaben wie EG-GMP-Richtlinie, PharmBetrV, PIC-Dokument PH 6/93 oder WHO-GMP wird ein System (Qualitätssicherung) verlangt, das sicherstellt, daß alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden, damit Arzneimittel die für den beabsichtigten Gebrauch erforderliche Qualität aufweisen. Außerdem wird die aktive Einbeziehung der Geschäftsleitung und des Personals auf der ausfuhrenden Ebene gefordert. Ergänzend zu den gesetzlichen Regelungen ist die Verpflichtung, weitere Faktoren auf der Vorgabenseite zu beachten und zu erfüllen. Da alle Rahmenbedingungen keine konkrete Definition eines Qualitätssicherungssystems und dessen Funktionsweise beinhalten und für die detaillierte Umsetzung in einem Unternehmen keine weiterhelfende Entscheidungstiefe darlegen, können hierfür Hilfestellungen aus anderen, z. B. nicht branchenspezifischen Regelungen wie der DIN EN ISO 9001 ff. und hier speziell der DIN ISO 9004 herangezogen werden. Systeme, die den umfassenden Anforderungen eines Qualitätssicherungssystems sinnvoll und zielgerichtet gerecht werden, sind im Grunde genommen nur durch neue Strukturen im gesamten Unternehmen zu etablieren. Des weiteren ist die fortlaufende Überwachung und der weitere Ausbau des Systems selbst sowie die erstmalige Implementierung im Prinzip nur durch Personen oder Abteilungen sinnvoll und wirtschaftlich zu erreichen, die sich ausschließlich um die Umsetzung der hieran gestellten Anforderungen bemühen. Im Teil I dieser Publikationsfolge wird die Notwendigkeit der Benennung eines Qualitätssicherungsbeauftragten beschrieben. Teil II wird sich mit dem Aufbau der Aufrechterhaltung und dem Ausbau eines Qualitätssicherungssystems sowie mit der Erweiterung auf andere, im pharmazeutischen Regelwerk nur wenig oder nicht regulierte Bereiche beschäftigen. Hierbei wird Bezug genommen auf die QM-Normen DIN EN ISO 9000 ff. (Teil II erscheint in einer der nächsten Ausgaben dieser Zeitschrift). © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-
Das neue Impfstoffwerk in Tornau
Rubrik: Fachthemen
(Treffer aus pharmind, Nr. 01, Seite 7 (1999))
Das neue Impfstoffwerk in Tornau / Heene G
Das neue Impfstoffwerk in Tornau Prof. Gerd Heene und Dipl.-Ing. Christoph Proebst, Heene + Partner, Architekten l Ingenieure, Ludwigshafen/Rhein In den deutschen Wirtschaftsgazetten ist es ein Dauerthema: Die Investitionen in den neuen Bundesländern. Dabei spielen offenbar in der Berichterstattung die Fälle mit negativem Ausgang, die Insolvenzen, eine größere Rolle gegenüber den Beispielen, die Vorzeigecharakter haben. In der Nachbarschaft von Dessau wurde am 16. Oktober 1997 das neue Produktionsgebäude des Impfstoffwerkes Dessau-Tornau GmbH in Anwesenheit von Ministerpräsident Höppner in Betrieb genommen. Das Werk ist eine völlige Neukonzeption auf dem Gelände des ehemaligen DDR-Impfstoffwerks. Das Impfstoffwerk Dessau-Tornau ist ein Unternehmen, das auf eine mehr als 75jährige Erfahrung bei der Bekämpfung von Krankheitserregern zurückblicken kann. Im Zusammenhang mit der Privatisierung im Jahr 1993 konzentrierte sich die Firma auf die Entwicklung und Produktion von veterinärmedizinischen Präparaten sowie die pharmazeutische Lohnfertigung. Gegenwärtig sind 220 Mitarbeiter beschäftigt. Eine stabile wirtschaftliche Entwicklung ermöglichte erhebliche Investitionen in neue Produktionsanlagen, Forschung und Marketing. Bekannt wurde das Unternehmen durch den 1992 weltweit ersten zugelassenen Lebendimpfstoff gegen die Salmonellose beim Geflügel. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-
Deutsche Gesellschaft für Regulatory Affairs (DGRA) / Eine Darstellung des Gesellschaftsprofils und der Zielsetzungen
Rubrik: Fachthemen
(Treffer aus pharmind, Nr. 02, Seite 108 (1999))
Deutsche Gesellschaft für Regulatory Affairs (DGRA) / Eine Darstellung des Gesellschaftsprofils und der Zielsetzungen / Schweim H
Deutsche Gesellschaft für Regulatory Affairs (DGRA) Eine Darstellung des Gesellschaftsprofils und der Zielsetzungen Prof. Dr. rer. nat. habil. Harald G. Schweim, Vorsitzender der DGRA, Köln Regulatory Affairs Manager war bisher in Deutschland kein Lernberuf, sondern Lehrberuf. Die akademische Voraussetzung ist vorzugsweise ein naturwissenschaftliches Fach, in erster Linie Pharmazie. Die eigentliche Ausbildung in Regulatory Affairs findet dann in den Firmen statt, ergänzt durch Seminare oder Arbeitskreise. Für dieses ,,Training on the Job ist ein Ansprechpartner mit langjähriger Erfahrung eine elementare Voraussetzung, der die ersten 2 Jahre den Weg des Anfängers begleiten sollte. Ausgewiesener Experte in diesem Fach ist man nach etwa 6 Jahren. Die Europäisierung der Arzneimittelzulassung und der nachfolgenden Vermarktung verlangt nach qualifizierten Gesprächspartnern für die Zulassungs- und Überwachungsbehörden. Die Arzneimittelzulassung ist heute wichtiger Bestandteil der Firmenpolitik: rasche Zulassung bedeutet rascher Marktzutritt und damit Umsatz in kürzester Zeit. Eine effiziente Unternehmenspolitik wird daher alle Aktivitäten auf dieses Ziel hin ausrichten und die Projektsteuerung unter Einschluß von Regulatory Affairs in jeder Hinsicht unterstützen. Der Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse muß zu jedem Zeitpunkt der Präparate-Entwicklung bekannt und umgesetzt sein, einschließlich einer Projektion der Anforderungen zum Zeitpunkt der Antragstellung. Das erfordert Kenntnisse in nahezu allen Bereichen von F&E, der Antragstellung und nachfolgenden Vermarktung. Eine systematische Aus-, Fort- und Weiterbildung ist daher vorrangiges Ziel der neu gegründeten Gesellschaft für Regulatory Affairs (DGRA). Wesentliche Impulse werden dabei durch die Anbindung an die Universität Bonn erwartet, die einen weiterbildenden Studiengang mit dem akademischen Abschluß eines ,,Expert for Drug Regulatory Affairs in naher Zukunft anbieten wird. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-
Aufbau, Implementierung und Ausbau eines Qualitätsmanagementsystems in einem pharmazeutischen Unternehmen / Zusammenführung der Qualitätsmanagementsysteme gemäß EG-GMP-Richtlinie, PharmBetrV und DIN EN ISO 9001/4 / Teil II: Aufbau, Ausbau und Aufrec
Rubrik: GMP / GLP / GCP
(Treffer aus pharmind, Nr. 02, Seite 111 (1999))
Aufbau, Implementierung und Ausbau eines Qualitätsmanagementsystems in einem pharmazeutischen Unternehmen / Zusammenführung der Qualitätsmanagementsysteme gemäß EG-GMP-Richtlinie, PharmBetrV und DIN EN ISO 9001/4 / Teil II: Aufbau, Ausbau und Aufrec / Prinz H
Aufbau, Implementierung und Ausbau eines Qualitätsmanagementsystems in einem pharmazeutischen Unternehmen Zusammenführung der Qualitätsmanagementsysteme gemäß EG-GMP-Richtlinie, PharmBetrV und DIN EN ISO 9001/4 Teil II: Aufbau, Ausbau und Aufrechterhaltung eines Qualitätsmanagementsystems*) Dr. Heinrich Prinz, Leiter Zentrale Qualitätssicherung, Biotest AG, Dreieich Durch die immer größer werdenden Anforderungen an die Herstellung und Qualitätskontrolle pharmazeutischer Produkte und somit auch allgemein an die Managementstrukturen aus regulatorischer Sicht ist es mittlerweile unumgänglich, einen Qualitätssicherungsbeauftragten oder eine Abteilung mit der Umsetzung und Überwachung der hieraus erwachsenen Aufgaben zu beauftragen (siehe Teil 1). Diese Abteilung hat konkret zum Ziel, ein System im Unternehmen zu etablieren, das die Umsetzung pharmazeutischer Regelwerke gewährleistet und damit den problemlosen Nachweis der Existenz eines geforderten Qualitätssicherungssystems durchführt. In diesem Teil II wird der Aufbau, die Aufrechterhaltung und der Ausbau eines Qualitätsmanagementsystems primär auf der Grundlage des EG-GMP-Leitfadens beschrieben. Ebenso soll beispielhaft die Erweiterung auf andere, im pharmazeutischen Regelwerk nur wenig regulierte Bereiche und Abläufe angesprochen werden, die notwendigerweise die Einhaltung von GMP-Vorgaben unterstützen bzw. fördern. Weiterhin wird Bezug auf die QM-Normen DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 9004 genommen, die hilfreiche Unterstützungen und Anhaltspunkte bei den Erweiterungen geben können und somit das gesamte Bild eines umfassenden Systems abrunden. *) Teil 1 siehe Pharm. Ind. 61, Heft 1, S. 19 (1999). © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-
Rechtsprechung - Publikumswerbung mit Warentest unzulässig / Kriterien für Wettbewerbsverein
Rubrik: Gesetz und Recht
(Treffer aus pharmind, Nr. 02, Seite 136 (1999))
Rechtsprechung - Publikumswerbung mit Warentest unzulässig / Kriterien für Wettbewerbsverein /
Publikumswerbung mit Warentest unzulässig / Kriterien für Wettbewerbsverein (BGH, Urteil vom 10. Juli 1997, Az.: I ZR 51/95) Ausgewählt von RA Dr. Axel Sander Die Publikumswerbung mit dem Hinweis auf ein Testergebnis der Stiftung Warentest verstößt gegen das heilmittelwerberechtliche Verbot der Werbung mit fachlichen Empfehlungen. Bei der Frage, ob einem Wettbewerbsverein eine ,,erhebliche Zahl von Gewerbetreibenden angehört, sind diejenigen Mitglieder des Vereins zu berücksichtigen, die der Beklagten auf demselben räumlichen und sachlichen Markt als Wettbewerber begegnen, also mit ihm um Kunden konkurrieren können. Der räumliche Markt wird durch die Geschäftstätigkeit des Werbenden bestimmt (z. B. die Bundesrepublik Deutschland). Für die Bestimmung des sachlichen Marktes reichen abstrakte Wettbewerbsverhältnisse. Es ist bei der Werbung für Arzneimittel nicht nur der enge Markt der Hersteller und Vertreiber der gleichen Arzneimittel, sondern von pharmazeutischen Präparaten schlechthin, anderen Mitteln (Medizintechnik) und Verfahren (Kurkliniken) und u. U. auch von Kosmetika einzubeziehen. Hinsichtlich der Anzahl der einschlägigen Vereinsmitglieder reicht es, daß sie nach Zahl, Größe, Marktbedeutung oder wirtschaftlichem Gewicht die Branche repräsentativ vertreten, so daß ein mißbräuchliches Vorgehen des Verbandes ausgeschlossen werden kann. Das Urteil hat folgenden Wortlaut (Auszug): © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999 -
4. Deutsche GMP-Konferenz (Teil 2) am 23./24. 11. 98 in Bad Soden
Rubrik: Tagungsberichte
(Treffer aus pharmind, Nr. 02, Seite 167 (1999))
4. Deutsche GMP-Konferenz (Teil 2) am 23./24. 11. 98 in Bad Soden / Maas A
4. Deutsche GMP-Konferenz Forum für internationale Kontakte mit Behördenvertretern aus Deutschland und der Schweiz sowie von der EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) Teil 2*) Dr. Johanne Meske (Schering AG, Berlin) und Anita Maas (Pharma Training Service, Arnsberg) Der nachfolgende zweite Teil des Berichtes über die 4. Deutsche GMP-Konferenz (Teil 1 siehe Pharm. Ind. 61, Nr. 1, S. 63; 1999) behandelt den Beitrag von Dr. Steven Fairschild über die Rolle der EMEA in London sowie die Entwicklung bei GMP für Wirkstoffe. Im Rahmen des zentralisierten Zulassungsverfahrens finden auch. von der EMEA veranlaßte pre-approval Inspektionen statt. Zulassung und Überwachung werden zukünftig enger miteinander verzahnt sein. Eine weitere Aktivität der EMEA, initiiert durch die MRAs, sieht Dr. Fairchild in der Harmonisierung der Überwachung in den EU-Ländern. Für die Anforderungen an die Wirkstoffherstellung erarbeitet die ICH eine weltweit harmonisierte Leitlinie. Diskutiert wird u: a., ab welchem Syntheseschritt die GMP-Regeln anzuwenden sind. Eine Überwachung findet bereits bei Import und Export von Wirkstoffen statt. Letztlich muß sich der pharmazeutische Unternehmer von der Qualität des eingesetzten Wirkstoffes überzeugen. *) Teil 1 siehe Pharm. Ind. 61, Heft 1, S. 63 (1999). © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-
Kostenverordnung für die Zulassung von Arzneimitteln
Rubrik: Gesetz und Recht
(Treffer aus pharmind, Nr. 11, Seite 1017 (1999))
Kostenverordnung für die Zulassung von Arzneimitteln / Peter F
Kostenverordnung für die Zulassung von Arzneimitteln RA Dr. Axel Sander und RA Felix Ludwig Peter, Geschäftsbereich Recht im Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V., Frankfurt/Main Die Kostenverordnung für die Zulassung von Arzneimitteln durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (im folgenden Kostenverordnung genannt) vom 16. September 1993 ist erneut - diesmal durch Verordnung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4054) - geändert worden und in ihrer geänderten Fassung am 1. Januar 1999 in Kraft getreten. Mit den Änderungen wurden viele Gebühren beträchtlich erhöht, was eine grundsätzliche Diskussion über die Zulässigkeit derartig hoher Gebührensteigerungen ausgelöst hat. Die Verfasser wollen im folgenden neben dieser Fragestellung auch auf Fragen eingehen, die sich immer wieder im Umgang mit der Kostenverordnung ergeben. Dies betrifft etwa das Entstehen und die Verjährung der Kostenschuld und den Rechtsschutz gegen Kostenbescheide. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
-
FIP-Kongreß '99 / Streiflichter für Industrieapotheker / Bericht vom Weltkongreß der Pharmazie vom 5. bis 10. September 1999 in Barcelona (Spanien)
Rubrik: Tagungsberichte
(Treffer aus pharmind, Nr. 11, Seite 1049 (1999))
FIP-Kongreß '99 / Streiflichter für Industrieapotheker / Bericht vom Weltkongreß der Pharmazie vom 5. bis 10. September 1999 in Barcelona (Spanien) / Oeser W
FIP-Kongreß 99 Streiflichter für Industrieapotheker / Bericht vom Weltkongreß der Pharmazie vom 5. bis 10. September 1999 in Barcelona (Spanien) Walter H. Oeser, Bad Kreuznach Der diesjährige Weltkongreß der Pharmazie und der pharmazeutischen Wissenschaften, der 59. Internationale Kongreß der Federation Internationale Pharmaceutique (FIP), fand vom 5. bis 10. September mit knapp 3000 Teilnehmern in Barcelona, Spanien, statt. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 1999
Sie sehen Artikel 11581 bis 11590 von insgesamt 11727
- Erste Seite
- 1157
- 1158
- 1159
- 1160
- 1161
- Letzte Seite