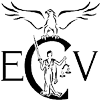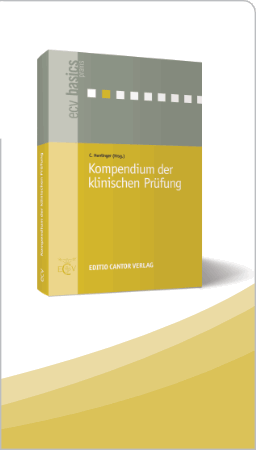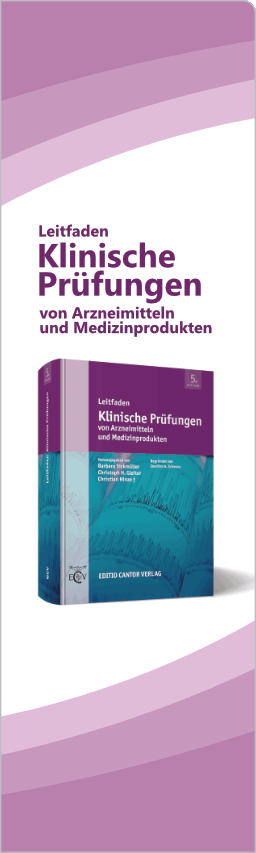Header
Ihr Suchergebnis
Sie recherchieren derzeit unangemeldet.Melden Sie sich an (Login) um den vollen Funktionsumfang der Datenbank nutzen zu können.
In der Rubrik Zeitschriften haben wir 11727 Beiträge für Sie gefunden
-
Laboratory Resource Planning for Quality Control of Pharmaceuticals
Rubrik: -
(Treffer aus pharmind, Nr. 11, Seite 1430 (2004))
Laboratory Resource Planning for Quality Control of Pharmaceuticals / Bühl W
Laboratory Resource Planning for Quality Control of Pharmaceuticals Dr. Walter Bühla, Joachim Daniela, Dr. Martin Höyncka, Dr. Winfried Jänickeb, and Dr. Sabine Szarowskib Merckle GmbHa, Ulm (Germany), and OR Soft Jänicke GmbHb, Merseburg (Germany) Planung von Laborressourcen bei der Qualitätskontrolle pharmazeutischer Produkte Im nachfolgenden Beitrag wird beschrieben, wie sich die Produktionsplanung fester Arzneimittel durch eine untergeordnete Laborressourcenplanung (Arbeitskräfte, HPLC-Anlagen usw.) für die Qualitätskontrolle ergänzen lassen. Ziel dabei ist es, die Arbeit im Labor so zu organisieren, daß die Fertigprodukte rechtzeitig ausgeliefert werden können. Dargestellt wird, wie man Plan- und Fertigungsaufträge aus dem Produktionsplanungsmodul mit simulierten Prüfaufträgen aus dem Qualitätskontrolle-Modul in einem Addon zu PPS-Systemen zusammenführt. Mittels dieses Addons können die Datenobjekte in Browsern zusammengeführt und als Gantt-Charts visualisiert werden. Eine verbesserte Überschaubar-keit und eine automatisierte, technologisch zulässige Ressourcenbelegungsplanung lassen sich so erreichen. Ein dynamischer Pegging-Algorithmus wird genutzt, um zu einer produktionsstufen-übergreifenden Terminberechnung zu kommen. Grundlage des Beitrages ist eine Implementierung im SAP R/3-Umfeld. Key words Laboratory scheduling, duetime testing, personnel • SAP R/3, QM, PP-PI © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2004
-
Manufacturing Execution Systems to Optimize the Pharmaceutical Supply Chain
Rubrik: -
(Treffer aus pharmind, Nr. 11, Seite 1414 (2004))
Manufacturing Execution Systems to Optimize the Pharmaceutical Supply Chain / Blumenthal R
Manufacturing Execution Systems to Optimize the Pharmaceutical Supply Chain Rolf Blumenthal Werum Software & Systems AG, Lüneburg (Germany) Optimierung der Supply Chain in Pharmaunternehmen durch den Einsatz von Manufacturing Execution Systemen Ein Manufacturing Execution System (MES) ist ein System, mit dem die Pharmaindustrie signifikante Verbesserungen bei den Herstellungskosten und in der Compliance zu behördlichen Anforderungen erzielt. Begründet ist dies durch die Fähigkeit, Geschäftsprozesse in der Supply Chain der Produktion zu optimieren, die Produktqualität zu verbessern und die Sicherheit der Herstellungsprozesse zu erhöhen. Der folgende Beitrag gibt praktische Ratschläge, wie eine MES-Lösung in einem Pharmaunternehmen mit Erfolg eingeführt werden kann. Dazu durchleuchtet er verschiedene Produktionsstrukturen sowie deren Prozeßabläufe und bietet Kriterien, um Nutzen und Funktionsumfang eines MES-Systems zu bestimmen. Vermittelt und erläutert werden notwendige Funktionen und Schnittstellen sowie Einführungsstrategien. Fallbeispiele von implementierten MES-Systemen dokumentieren den erreichten Nutzen für die Unternehmen. Key words Biopharmaceutical manufacturing • Electronic batch recording • Electronic signature • Good Manufacturing Practice compliance • Manufacturing execution system • Pharmaceutical production • Supply chain © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2004
-
Compliant Manufacturing with SAP in the Pharmaceutical Industry / Extending software applications from top floor to shop floor streamlines compliant manufacturing processes for pharmaceutical companies
Rubrik: -
(Treffer aus pharmind, Nr. 11, Seite 1405 (2004))
Compliant Manufacturing with SAP in the Pharmaceutical Industry / Extending software applications from top floor to shop floor streamlines compliant manufacturing processes for pharmaceutical companies / Sabogal J
Compliant Manufacturing with SAP in the Pharmaceutical Industry Extending software applications from top floor to shop floor streamlines compliant manufacturing processes for pharmaceutical companies James Sabogala and Dr. Jürgen Thölkeb SAP Labsa, Newtown Square, PA (USA), and SAP AGb, Walldorf (Germany) Einsatz von SAP-Lösungen für Compliant Manufacturing in der Pharmaindustrie / „Erweiterung von ERP in die Fertigung“ Pharmaunternehmen stehen vor globalen Marktveränderungen, auf die es angemessen zu reagieren gilt - Preis- und Kostendruck, sinkende Margen, rückläufige Marktanteile von Originalpräparaten, zunehmende legislative Regularien. Das Qualitätsmanagement wird noch wichtiger, die Produktion muß präzise an die Nachfrage angepaßt sein, um unnötige Lagerhaltung ebenso zu vermeiden wie zu geringe Bestände. Neue Regularien wie etwa die Bestimmungen der FDA zur Validierung von Arzneimitteln (Federal Drug Association Part 11 Compliance) oder entsprechende Vorschriften der EU verlangen klar definierte Produktions- und Überwachungsprozesse. Neue Technologien und Methoden in der Herstellung wie etwa Radio Frequency Identification (RFID), Prozeßkontrolle mit analytischen Methoden (PAT) oder bedarfsorientierte Logistiknetzwerke erfordern zusätzliche Investitionen. Der folgende Beitrag erläutert Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Durch die Integration von Geschäftslösungen mit fertigungsnahen Anwendungen, einem “erweiterten ERP bis zur Fertigungshalle”, wird eine umfassende Produktions- und Lieferkettensteuerung in Echtzeit erreicht. Die Integration der Logi-stikprozesse und die Verwendung von Technologien wie RFID erhöhen die Flexibilität. Pharmahersteller werden dadurch schneller, steigern ihre Agilität und die Transparenz sämtlicher Fertigungsprozesse. Ein Beispiel-Szenario zeigt, wie ein Produzent mit der SAP-Lösung für Compliant Manu-facturing eine Kostensenkung um 10 % und die Übereinstimmung mit allen FDA-Regularien erreicht hat. Key words Compliance • Pharmaceutical manufacturing • Quality • SAP Manufacturing • Supply Chain Execution © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2004
-
Process Reliability and Flexibility - A Tool to Improve Pharmaceutical Plan Floor Operations
Rubrik: -
(Treffer aus pharmind, Nr. 11, Seite 1399 (2004))
Process Reliability and Flexibility - A Tool to Improve Pharmaceutical Plan Floor Operations / Geismar D
Process Reliability and Flexibility -A Tool to Improve Pharmaceutical Plan Floor Operations David Geismar and Glenn White CSC Consulting Group, Global Health Solutions, Berwyn (USA) Prozeßzuverlässigkeit und -flexibilität -Eine Methode zur Steigerung der Effizienz von Produktionsabläufen in der Pharmaindustrie Die primären Faktoren, welche die Hersteller pharmazeutischer Produkte heute beeinflussen, sind Kosten und die Erfül-lung der Compliance-Anforderungen (Good Manufacturing Practice). Bekannte Methoden zur Reduktion von Produktionskosten sind „Lean Manufactur-ing“, „6 Sigma“ oder eine Kombination dieser beiden Vorgehensweisen: „Lean 6 Sigma“. Werden diese Methoden korrekt angewendet und umgesetzt, sind sie ebenfalls geeignet, die regulatorischen Anforderungen von cGMP zu unterstützen. Die Hauptelemente für ein erfolgreiches „Lean 6 Sigma“-Programm sind Flexibilität und Prozeßzuverlässigkeit. Die Prozeßzuverlässigkeit ist die Grundanforderung eines jeden 6-Sigma-Programms, die auch die Umsetzung cGMP-konformer Produktionsprozesse in einem validierten Umfeld beinhaltet. Flexibilität im Produktionsprozeß bildet die Grundlage für schnelle Umrüstungen und Reduktionen von Lagerbeständen und ermöglicht somit die Erreichung von „Lean Manufacturing“. Zusätzlich ermöglicht Flexibilität dem Produzenten, flexibler auf Kunden-wünsche einzugehen - der Schlüssel, um auch zukünftig erfolgreich zu sein. Key words Good Manufacturing Practices compliance • Lean manufacturing • Process flexibility • Process reliability • 6 Sigma • Uptime • Validation © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2004
-
Validiertes Vorgehen bei einem globalen SAP-Rollout
Rubrik: Praxis
(Treffer aus pharmind, Nr. 11, Seite 1379 (2004))
Validiertes Vorgehen bei einem globalen SAP-Rollout / Wanzke M
Validiertes Vorgehen bei einem globalen SAP-Rollout Michael Wanzke Siemens Business Services, München Die Altana Pharma AG hat eine globale SAP-Einführung an Standorten in drei Kontinenten abgeschlossen. In Bombay, Sydney, Stockholm und Konstanz haben Projektteams in drei Zeitzonen parallel daran gearbeitet, die Integration der SAP-Systeme von drei Landesgesellschaften in ein einziges System umzusetzen. Der Schlüssel zum erfolgreichen Abschluß war die Zusammenarbeit mit einem international aufgestellten Dienstleister. Für Altana Pharma rechnet sich das Projekt bereits im ersten Jahr nach der Einführung. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2004
-
Die Kostensteigerung kommt, der Protestschrei auch
Rubrik: Aspekte
(Treffer aus pharmind, Nr. 11, Seite 1283 (2004))
Die Kostensteigerung kommt, der Protestschrei auch / Postina T
-
Practical Use of Supply Chain Management in the Pharmaceutical Industry / From concept to implementation
Rubrik: -
(Treffer aus pharmind, Nr. 11, Seite 1391 (2004))
Practical Use of Supply Chain Management in the Pharmaceutical Industry / From concept to implementation / Siat J
Practical Use of Supply Chain Management in the Pharmaceutical Industry From concept to implementation Jerome Siat Computer Sciences Corporation (CSC), Paris (France) Praktischer Einsatz des Supply Chain-Managements in der Pharmaindustrie / Vom Entwurf zur Realisierung Der Beitrag beschreibt die komplexe Umgebung der Logistik (Supply Chain) der Industrie im Bereich der Gesundheitsfür-sorge und der Life Sciences; die täglichen Abläufe in Projekten werden ebenfalls kurz vorgestellt: entscheidende Teile, Risiken, Methodik, Planung und Erfahrungen. Dann wird der Schwerpunkt auf der Reife der Unternehmen für Supply Chain liegen und auf dem Umstand, daß es den Weg zur Zusammenarbeit gibt, daß er aber lang und schwierig ist. Auf dieser Grundlage werden die Zukunftsvisionen des Supply Chain Management und seine Vorteile für die Verbesserung zukünftiger Projekte beschrieben. Key Words Supply chain management, forecasts, maturity, methodology, performance, planning, stakes, symptoms © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2004
-
Barriereeigenschaften von Pharmafolien aus Cycloolefin-Copolymeren
Rubrik: Originale
(Treffer aus pharmind, Nr. 11, Seite 1373 (2004))
Barriereeigenschaften von Pharmafolien aus Cycloolefin-Copolymeren / Beer E
Barriereeigenschaften von Pharmafolien aus Cycloolefin-Copolymeren Ekkehard Beer und Dirk Heukelbach Ticona GmbH, Kelsterbach Die Kunststoffklasse der Cycloolefin-Copolymere (COC) ermöglicht es erstmals, hochwirksame Barrierefolien auf rein polyolefinischer Basis herzustellen. Diese Kunststoffe sind halogenfrei, farblos, glasklar und biokompatibel. Sie nehmen fast kein Wasser auf und stellen bereits in dünner Schicht eine wirksame Wasserdampfbarriere dar. Folien mit COC als barrierewirksamer Schicht lassen sich auf herkömmlichen Blisteranlagen ohne Veränderungen an den Formwerkzeugen weiterverarbeiten. Vergleichende Untersuchungen mehrerer Pharmaunternehmen an Blisterpackungen aus unterschiedlichen Folien haben gezeigt, daß COC-Folien Arzneimittel hervorragend vor Feuchtigkeitsaufnahme schützen und daß dieser Schutz unter extremen Klimabedingungen weniger stark abnimmt als bei etablierten Blisterfolien. Dadurch lassen sich Blisterpackungen für feuchtigkeitsempfindliche Arzneimittel für alle Regionen weltweit aus derselben COC-Folie herstellen. Key words Blister • Cycloolefin-Copolymere • Pharmafolien, Barrierewirkung © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2004
-
In vitro and in vivo Evaluation of Floating Controlled Release Dosage Forms of Verapamil Hydrochloride
Rubrik: Originale
(Treffer aus pharmind, Nr. 11, Seite 1364 (2004))
In vitro and in vivo Evaluation of Floating Controlled Release Dosage Forms of Verapamil Hydrochloride / Alkhaled F
In vitro and in vivo Evaluation of Floating Controlled Release Dosage Forms of Verapamil Hydrochloride Seham A. Elkheshen*, Alaa Eldeen B. Yassin, Saleh Alsuwayeh, and Fayza A. Alkhaled Department of Pharmaceutics, Collage of Pharmacy, King Saud University, Riyadh (Saudi Arabia) * Present address: see address for correspondence Untersuchung von flotierenden Formulierungen zur kontrollierten Freisetzung von Verapamil-Hydrochlorid in vitro und in vivo Untersuchungen über die Zubereitung flotierender Systeme für die verzögerte Freisetzung von Verapamil-Hydrochlorid werden beschrieben; verschiedene Hydrokolloid-Polymere einschließlich Hydroxy-propylmehtylcellulose (HPMC), Hyroxy-propylcellulose, Ethylcellulose und Carbopol wurden eingesetzt. Flotation wurde durch den Zusatz einer gasbildenden Mischung von Natriumbicarbonat und wasserfreier Zitronensäure erreicht. Einige Faktoren mit Einfluß auf Flotation und Wirkstofffreisetzung wurden untersucht, u. a. Wirkstoff-Polymer-Verhältnis, Granuliermittel, Zusatz von freisetzungsverzögernden Mitteln, Überziehen der Granula mit Ethylcellulose, Verpressen des Granulates zu Tabletten. Für die In-vivo-Prüfung im Vergleich mit einem kommerziell erhältlichen Verapamil-Hydrochlorid-Produkt mit kontrollierter Freisetzung wurde eine Formulierung ausgewählt, die Verapamil und HPMC im Verhältnis 1:1 sowie 5 % gasbildende Agentien enthält, mit 96 % Alkohol naß granuliert und anschließend ver-preßt wurde. Von beiden Präparaten wurde bei Beagle-Hunden die Bioverfügbarkeit sowie die Retention im Magen röntgenologisch untersucht. Die Ergebnisse zeigen, daß bei den in Kapseln verfüllten Pulvermischungen nur solche mit HPMC-4000 sowohl Flotation als auch annehmbare Verzögerung der Freisetzung ergeben. Die Granulierung derselben Pulverformulierungen führte zu einem vollständigen Verlust sowohl der Flotation als auch der Verzögerung der Freisetzung. Die Tablettierung von Granulaten mit verschiedenen Verapamil-HPMC-4000-Verhältnissen ergab ausgezeichnetes Aufschwimmen und langsame Freisetzungsprofile. Durch die Flotation wurde die Entleerung der Verapamil-Tabletten aus dem Magen von Beagle-Hunden um mehr als vier Stunden verzögert - im Vergleich zu nahezu einer Stunde bei einem Kontrollpräparat ohne gelbildendem Polymer und ohne gasbildende Zusätze. Die flotierende Tablettenzubereitung zeigte Bioäquivalenz mit einer handelsüblichen Tablette mit verzögerter Freisetzung, wobei mittlere AUC0-, Cmax und tmax nicht signifikant höhere Werte hatten. Key words Buoyancy dosage forms • Floating dosage forms • Gastroretentive dosage forms • Hydrodynamically balanced systems • Hydrophilic matrix polymers • Verapamil hydrochloride © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2004
-
GMP-gerechte Dokumentation: Anforderungen aus Behördensicht
Rubrik: GMP-Aspekte in der Praxis
(Treffer aus pharmind, Nr. 11, Seite 1356 (2004))
GMP-gerechte Dokumentation: Anforderungen aus Behördensicht / Hiob M
Sie sehen Artikel 9911 bis 9920 von insgesamt 11727
- Erste Seite
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- Letzte Seite