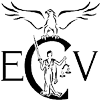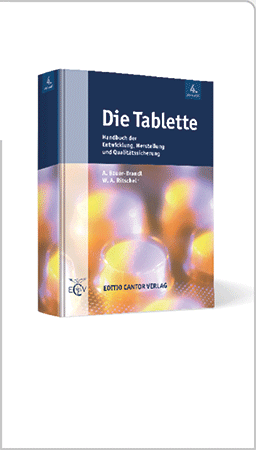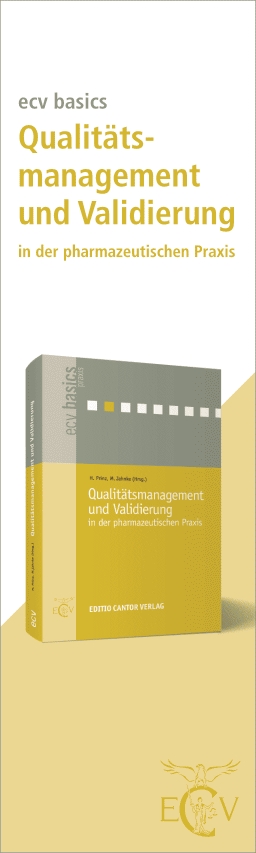Ihr Suchergebnis
Sie recherchieren derzeit unangemeldet.Melden Sie sich an (Login) um den vollen Funktionsumfang der Datenbank nutzen zu können.
In der Rubrik Zeitschriften haben wir 11938 Beiträge für Sie gefunden
-

Sachverständigen-Ausschuß für Standardzulassungen berufen
Rubrik: Aktuelles
(Treffer aus pharmind, Nr. 05, Seite 505 (2005))
Sachverständigen-Ausschuß für Standardzulassungen berufen / Auterhoff G
-

IMS HEALTH: Aktuelle Daten zum GKV-Arzneimittelmarkt in Deutschland 05/2005
Rubrik: Aktuelles
(Treffer aus pharmind, Nr. 05, Seite 503 (2005))
IMS HEALTH: Aktuelle Daten zum GKV-Arzneimittelmarkt in Deutschland 05/2005 /
-

Alternskalender Haut
Rubrik: Aus Wissenschaft und Forschung
(Treffer aus pharmind, Nr. 05, Seite 500 (2005))
Alternskalender Haut / Reitz M
Alternskalender Haut Für den Menschen ist die Haut ein Alternskalender. Die Haut bleibt zwar während des gesamten Lebens regenerationsfähig, dennoch wird sie im Alter immer dünner und faltenreicher. Die Haut ist in Schichten untergliedert und jede einzelne Schicht zeichnet sich durch besondere Alternsmechanismen aus. Die Hautalterung hat eine intrinsische und extrinsische Ursache und kann deshalb nur sehr beschränkt beeinflußt werden; verhindern läßt sie sich nicht. UV-Licht, Rauchen und insbesondere oxidative Stressfaktoren fördern die Hautalterung. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2005
-

Biotechnologische Arzneimittel auf Erfolgskurs, Nachahmer in den Startlöchern
Rubrik: Streiflichter
(Treffer aus pharmind, Nr. 05, Seite 497 (2005))
Biotechnologische Arzneimittel auf Erfolgskurs, Nachahmer in den Startlöchern / Fink-Anthe C
-

GKV-Modernisierungsgesetz: Krankenkassen ziehen ernüchternde Bilanz
Rubrik: Aspekte
(Treffer aus pharmind, Nr. 05, Seite 495 (2005))
GKV-Modernisierungsgesetz: Krankenkassen ziehen ernüchternde Bilanz / Postina T
-

Produktinformationen 04/2005
Rubrik: Produktinformationen
(Treffer aus pharmind, Nr. 04, Seite 489 (2005))
Produktinformationen 04/2005 /
-

Aktuelle Entwicklungen bei der Reinwasser-Herstellung mit Membranverfahren
Rubrik: Praxis
(Treffer aus pharmind, Nr. 04, Seite 484 (2005))
Aktuelle Entwicklungen bei der Reinwasser-Herstellung mit Membranverfahren / Jacob A
Aktuelle Entwicklungen bei der Reinwasser-Herstellung mit Membranverfahren Axel Jacob Christ Water Technology Group, Aesch/BL (Schweiz) Membranverfahren gewinnen bei der Wasseraufbereitung in Pharmaunternehmen zunehmend an Bedeutung. Der nachfolgende Beitrag beschreibt Unterschiede und Einsatzgebiete der Verfahren Ultra- und Nanofiltration sowie der Umkehrosmose. Einen Schwerpunkt bildet die am häufigsten verwendete Umkehrosmose mit den am Markt verfügbaren Modulen. Darüber hinaus werden bei der Vorbehandlung zu beachtende Parameter, Reinigungs- und Sanitisierungsmethoden sowie technische Grenzen, Neuentwicklungen und Trends behandelt. © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2005
-

Anwendung der Risikoanalyse HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) in der Produkteinführung und zur Festlegung eines Validierungsplanes
Rubrik: Sonderthema
(Treffer aus pharmind, Nr. 04, Seite 471 (2005))
Anwendung der Risikoanalyse HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) in der Produkteinführung und zur Festlegung eines Validierungsplanes / Jahnke M
Anwendung der Risikoanalyse HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) in der Produkteinführung und zur Festlegung eines Validierungsplanes Manfred Jantsch, Dr. Bettina Trotte, Birgit Schunke und Dr. Michael Jahnke Wülfing Pharma GmbH, Gronau Die Risikoanalyse nach dem HACCP-Konzept wurde angewendet, um die notwendigen Validierungsmaßnahmen bei der Einführung eines aseptischen Prozesses, der Abfüllung sterilen Pulvers in Glas-vials, festzulegen. Im multidisziplinären Arbeitsteam wurde zunächst die Vorgehensweise zur Durchführung einer Risikoanalyse nach dem HACCP-Konzept er-läutert und anschließend der Herstellungsprozeß und seine Umgebungsfaktoren auf potentielle qualitätsbeeinflussende Risiken analysiert. In einer Tabelle wurden potentielle Risiken benannt und bewertet, Maßnahmen zur Risikominderung festgelegt und unkontrollierte Risiken in einem produktspezifischen Validierungsplan zusammengefaßt. Als Beispiele des produktspezifischen Validierungsplanes werden im nachfolgenden Beitrag die Qualifizierung neu zu gestaltender Räume und raumlufttechnischer Anlagen sowie die Qualifizierungs-maßnahmen der Abfüll-Linie beschrieben. Key words HACCP • Produkteinführung • Qualifizierung • Risikoanalyse • Technologietransfer © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2005
-

FDA-konforme Validierung analytischer Methoden
Rubrik: Sonderthema
(Treffer aus pharmind, Nr. 04, Seite 462 (2005))
FDA-konforme Validierung analytischer Methoden / Trantow T
FDA-konforme Validierung analytischer Methoden Dr. Thomas Trantow Analytik-Service Dr. T. Trantow, Schöneiche bei Berlin Die nachfolgende Arbeit gibt zunächst eine Übersicht über die für FDA-konforme Validierungen analytischer Methoden geltenden Regelwerke. Dabei wird auch auf aktuelle Entwürfe validierungsrelevanter Guidances eingegangen. Unter „Grundsätzliche Anforderungen“ werden Validierungsvoraussetzungen, Inhalte von Methodenbeschreibungen, statistische Grundüberlegungen, Bedeutung der Rohdaten sowie Grundsätzliches zum Validierungsplan und Validierungsbericht dargestellt. Die zur Methodenvalidierung relevanten Qualitätsmerkmale analytischer Methoden werden als Validierungsparameter vorgestellt und den verschiedenen Typen von Analysenmethoden zugeordnet. Hinweise zum Setzen von Akzeptanzkriterien sowie eine Übersicht der für Validierungsstudien verfügbaren Methoden vervollständigen die grundlegenden Darstellungen. Im zweiten Teil werden für die Validierungsparameter jeweils ihre Bedeutung, die Kernforderungen der Regelwerke und regelkonforme Vorgehensweisen dargestellt. Hinweise zu Laborkapazität-sparenden Kombinationsversuchen und Entwicklungsprojekten schließen diese Übersicht ab. Key words Arzneimittel-Analytik • FDA • ICH • Methodenvalidierung Qualitätskontrolle © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2005
-

Vorbereitung und Begleitung von FDA-Inspektionen
Rubrik: Sonderthema
(Treffer aus pharmind, Nr. 04, Seite 455 (2005))
Vorbereitung und Begleitung von FDA-Inspektionen / Fetsch J
Vorbereitung und Begleitung von FDA-Inspektionen Dr. Jörg Fetsch und Denise Mocha Schering AG, QES-Audit, Berlin Inspektionen durch Behörden zur Überprüfung der GMP- und Zulassungskonformität bei der Herstellung von Arzneimitteln erfolgen in pharmazeutischen Unternehmen routinemäßig. Dabei werden Inspektionen nicht nur durch die lokale Überwachungsbehörde, sondern auch durch Behörden fremder Staaten durch-geführt. Vor allem Inspektionen der amerikanischen Überwachungs- und Zulassungsbehörde, der FDA, haben einen hohen Stellenwert und lösen in der betroffenen Firma z. T. erhebliche zusätzliche Aktivitäten aus. Jedoch sind FDA-Inspektionen durch sorgfältige und gründliche Vorbereitung erfolgreich zu meistern. Der folgende Artikel beschreibt neben Inspektionsarten und möglichen Folgen einer FDA-Inspektion vor allem, wie FDA-Inspektionen vorzubereiten sind. Außerdem werden Verhaltensregeln definiert, die während der Inspektion von allen Mitarbeitern beachtet werden müssen. Alle Schritte im Rahmen der Inspektionsvorbereitung, aber auch die Verhaltensregeln, sind ohne weiteres auf jede Behördeninspektion anwendbar. Key words FDA • Inspektionen © ECV- Editio Cantor Verlag (Germany) 2005
Sie sehen Artikel 9711 bis 9720 von insgesamt 11938
- Erste Seite
- 970
- 971
- 972
- 973
- 974
- Letzte Seite